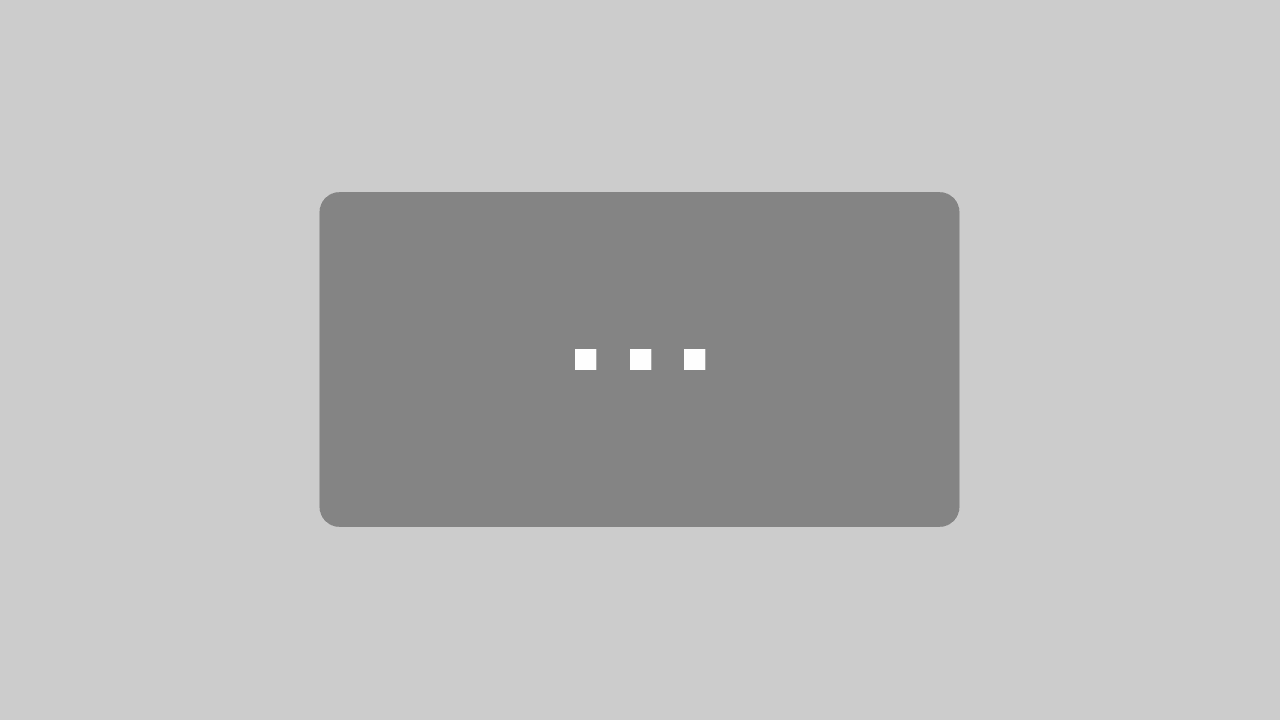Der virtuelle Blick in die Zukunft
Virtuelle (VR) und erweiterte Realität (AR) in politischen Teilhabeprozessen

Das Internet bietet Potential für eine hierarchiefreie Kommunikation, auch auf politischer Ebene. Entscheidungen können transparenter gestaltet werden und Verfahren direktdemokratisch stattfinden. Digitalisierungsprozesse können auch die politische Teilhabe beeinflussen und verändern. Um möglichst demokratische Entscheidungen zu fällen, sollen Bürger*innen aus der Rolle der Zuhörenden heraustreten, selbst aktiv werden und sich mit anderen austauschen. Neben E-Lobbyangeboten, E-Petitionen und anderen Online-Partizipationsaktivitäten soll es hier nun um eine Form der potenziellen Bürgerbeteiligung gehen, die mithilfe von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) verwirklicht werden kann. Wie sich diese beiden Technologien unterscheiden, wird in folgendem Erklärvideo beschrieben:
Durch E-Partizipation soll eine frühe Einbindung mehrerer Akteur*innen ermöglicht werden. Das bedeutet, dass neben den Regierungsverantwortlichen der Städte auch Forscher*innen oder demografisch relevante Bevölkerungsteile ohne zwingend vorhandene Fachkenntnisse in politische Verfahren mit einbezogen werden. Dies würde eine direkte Beteiligung an demokratischen Entscheidungsfindungen ermöglichen, von Bürger*innen mit persönlichem Bezug zu bestimmten Themenkomplexen. Sie müssen die Forschungsansätze und Vorhaben nicht zwangsläufig auf wissenschaftlichem Niveau verstehen. Vielmehr können sie durch den Einsatz von AR und VR in eine Zukunftssimulation einsteigen und beispielsweise eine mögliche Fußgänger*innen-Perspektive einnehmen und diese Eindrücke dann kommentieren.
Praxisbeispiele “Take Part” und “Mindspaces”
In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekt “Take Part”, das von 2018 bis 2021 stattfand, wurde AR und VR in ein Bürger*innenbeteiligungskonzept integriert. Das Team bestand aus mehreren Forschungseinrichtungen. Die im Projekt entwickelte App ermöglicht das Abstimmen und Diskutieren der Bewohner*innen zu Bauvorhaben oder anderen Themen. Mit einer solch einfachen und niedrigschwelligen Beteiligungsform will man Konflikte hinsichtlich Stadtbebauungsplänen durch frühzeitige Einbeziehung und Kommunikation vermeiden. Wichtig ist hier die frühzeitige Beteiligung, sodass die Partizipation nicht erst während der Bauumsetzung stattfindet. Wie im Video erklärt, wird bei AR die Umgebung mit virtuellen Elementen ergänzt (beispielsweise Texte oder Bilder). Bei der VR tauchen Nutzer*innen in eine komplett neue interaktive Welt ein. Die Take Part-App ist in der Lage, nachdem man bestimmte Marker gescannt hat, Visualisierungen der geplanten Objekte (z.B. einer Brücke oder einem Schild) über das Smartphone anzuzeigen.
Die EU finanziert derzeit das Projekt “Mindspaces”, das seit Januar 2019 läuft und Ende Juni 2022 abgeschlossen werden soll. Beteiligt sind Universitäten, Institute oder andere Einrichtungen aus verschiedenen EU Ländern, darunter Griechenland, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Niederlande und Deutschland. Emotions-, Text- und Verhaltensanalyse ermöglichen es in diesem Projekt, mit Hilfe von physiologischen Sensoren, die Vorlieben der Nutzer*innen in Bezug auf Stadtbeplanung herauszufinden. Auch Künstler*innen werden ermutigt, im Rahmen dieses Projektes, auf politische Teilhabe aufmerksam zu machen. Künstlerisch soll den Bewohner*innen ein Bewusstsein geschaffen werden, für mögliche Veränderungen ihrer Umgebung.
Potentiale und Zukunftsvisionen von AR und VR
Dies sind zwei Beispiele wie AR und VR als Tools für politische Partizipation genutzt werden können. Der technische Fortschritt ermöglicht eine realitätsnahe Empfindung der virtuellen Welt. Wie wichtig digitaler Fortschritt sowie Handlungs- und Reaktionsspielräume sind, wurde durch die Corona-Pandemie noch einmal verdeutlicht. Die öffentliche Infrastruktur ist vor allem in Krisenzeiten enorm wichtig. VR und AR werden daher vermutlich immer häufiger eingesetzt. Kritisch muss allerdings der juristische Rahmen betrachtet werden. Beispielsweise eignet sich das Partizipationssystem Take Part für private Bauprojekte. Für öffentliche Vorhaben fehlen allerdings oftmals noch Regularien. Das deutsche Baurecht sieht bisher noch vor, dass der Wille der Initiator*innen entscheidend ist, unabhängig von den möglichen Lösungswegen. Je häufiger Bürger*innen von diesen technischen Möglichkeiten erfahren, desto mehr stehen auch öffentliche Bauvorhaben unter Druck, diese interaktive Beteiligung zu nutzen. Es ist also denkbar, dass zukünftig neben Modellprojekten auch regelmäßig öffentliche Bauvorhaben zur VR und AR Technik greifen, um Bürger*innen an politischen Prozessen teilhaben zu lassen.
Wenn Sie mir mehr über digitale Teilhabe und Demokratie erfahren möchten, freuen wir uns auf Ihre Teilnahme am „d3-kongress: Deutschland. Digital. Demokratisch.“ im November.
Literaturhinweise
Die Zukunft gemeinsam gestalten. Das Handbuch Öffentlichkeitsbeteiligung Buch
Wien, 2005.
Regieren mit Mediation: Das Beteiligungsverfahren zur zukünftigen Entwicklung des Frankfurter Flughafens Buch
VS Verlag, Wiesbaden , 2005.
OECD Nuclear Energy Agency: Stepwise Approach to Decision Making for Longterm Radioactive Waste Management Buch
Experience, Paris, 2004.
What can democratic participation mean today? Artikel
In: Political Theory, Bd. 30, Nr. 5, S. 677-701, 2002.
Auswahlverfahren für Endlagerstandorte - Empfehlungen des AkEnd Forschungsbericht
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 2002.
Die Planungszelle. Der Bürger als Chance Buch
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden , 2002.
Neue Formen politischer Beteiligung Buchabschnitt
In: Ansgar Klein; Ruud Koopmans; Heiko Geiling (Hrsg.): Globalisierung, Partizipation, Protest, S. 255-274, Leske+Budrich, Opladen, 2001, ISBN: 978-3-322-94936-3.
Partizipation als Qualitätsmerkmal in der Heimerziehung: eine Diskussionsgrundlage Buch
Votum, Münster, 1999, ISBN: 9783933158147.
Der kooperative Diskurs. Theoretische Grundlagen, Anforderungen, Möglichkeiten Buchabschnitt
In: Ortwin Renn; Hans Kastenholz; Patrick Schild; Urs Wilhelm (Hrsg.): Abfallpolitik im kooperativen Diskurs. Bürgerbeteiligung bei der Standortsuche für eine Deponie im Kanton Aargau, S. 3-103, vdf, Zürich, 1998.
Rationalität durch Partizipation? Das mehrstufige dialogische Verfahren als Antwort auf gesellschaftliche Differenzierung. In: Konfliktregelung in der offenen Bürgergesellschaft Zeitschrift
Forum für interdisziplinäre Forschung, Bd. 17, 1996.