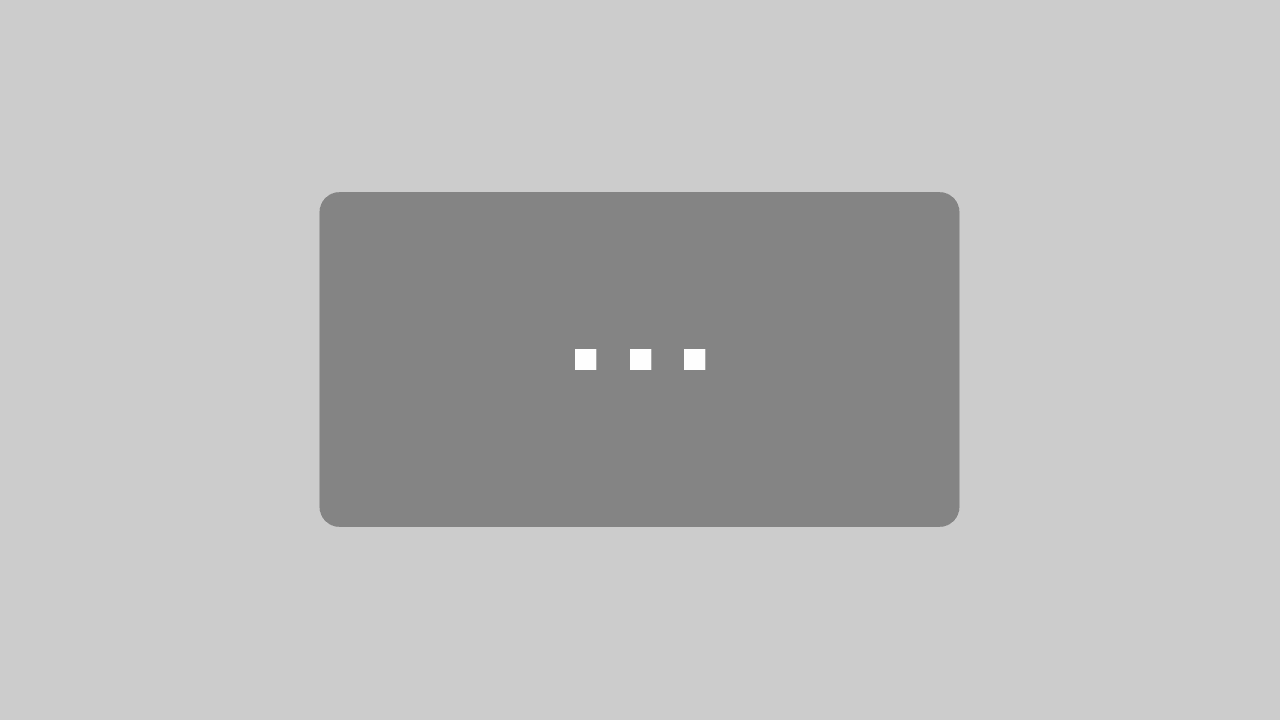Beteiligung durch Bildung: Die Universität für Geflüchtete
 Foto: Thomas Kohler via flickr.com , Lizenz: CC BY 2.0
Foto: Thomas Kohler via flickr.com , Lizenz: CC BY 2.0
Wer schon einmal versucht hat, sich an einer staatlichen deutschen Universität einzuschreiben, der hat auch die Welt von Asterix und Obelix geteilt. Die bekannten Comic-Helden von Goscinny und Uderzo müssen im Band ,,Asterix erobert Rom“ nämlich diverse als unlösbar geltende Aufgaben erledigen. Eine davon lautet, von einer römischen Behörde – der sogenannten Präfektur – das Dokument A38 zu erhalten. Die beiden Helden drohen sich im Dickicht der Verwaltungsbürokratie zu verirren und es gelingt ihnen letztlich durch einen Trick, die Aufgabe zu meistern.
Natürlich stellt das Bild eine Übertreibung des Bewerbungsverfahrens dar, dem sich ein Studienbewerber stellen muss und ,,austricksen“ kann er die Zulassungsstelle ebenfalls nicht.
Rechtliche Zulassungsbeschränkungen schaffen unüberwindbare Hürden
Doch während hiesige Abiturienten bestenfalls am Kopieren aller Nachweise von Geburtsurkunde bis letztem Zeugnis in dreifacher Ausführung und der Wahrung der Einreichungsfrist scheitern, schafft die deutsche Sprache für viele geflüchtete Studieninteressierte bereits eine unüberwindbare Hürde. Zudem sind ihre Unterlagen infolge der Flucht teilweise unvollständig und ausländische Abschlussgrade sind oft nicht den deutschen Abschlüssen gleichgestellt.
Eine Universität, die Geflüchteten unbürokratisch, schnell und gebührenfrei einen Zugang zu akademischer Bildung ermöglichen will.
Für die studieninteressierten Heimatlosen bedeutet das wertvollen Zeitverlust und Frustration; für asylgewährende Staaten im Anbetracht der Tatsache einer ungeklärten Flüchtlingsproblematik und auf Weiteres nicht behebbarer Flüchtlingsursachen ein unnötig nicht genutztes Reservoir an potentiellen (zukünftigen) Fachkräften. Dennoch ist es keiner staatlichen Politikmaßnahme zu verdanken, sondern einer Gruppe von Philanthropen, dass seit Oktober Geflüchteten die Möglichkeiten zu einem Studium geboten wird.
Eine virtuelle Universität will Abhilfe schaffen
Sie sind Gründer der Kiron University, einer non-profit NGO, die geflüchteten Menschen unbürokratisch,schnell und gebührenfrei einen Zugang zu akademischer Bildung ermöglichen will, wie Mitbegründer Martin Kressler im Video ausführt.
Aufbau und Finanzierung
Auf der Internetpräsenz der noch jungen Bildungseinrichtung werden Konzept und Ablauf erklärt: Schlüsselinstrument sind in englischer Sprache konzipierte Massive Open Online Courses (MOOCS). Dabei handelt es sich um online bereitgestellte Lehrveranstaltungen, die von namhaften Anbietern angeboten werden und auch in Havard, Stanford, Yale oder am MIT Anwendung finden. Sie werden durch weitere Kommunikationsmedien wie Chatrooms ergänzt, um den Studierenden fachbezogenen Austausch zu ermöglichen. Das Studium gliedert sich in mehrere Phasen. Zunächst erfolgt ein einjähriges Studium Generale ehe sich die Studierenden im zweiten Jahr auf einen von fünf möglichen Studiengängen festlegen. Das Auswahlspektrum ist breit und bietet von IT über Ingenieurwesen, Architektur oder Kulturwissenschaft bis hin zur Wirtschaftswissenschaft genügend Auswahl. Im dritten Jahr wechseln die Studenten an eine Partneruniversität und absolvieren den letzten Studienabschnitt im Präsenzbetrieb. Erst jetzt müssen sie die entsprechenden formalen Nachweise vorlegen, was ihnen Zeit verschafft.
Die Finanzierung der Kiron University erfolgt über Spenden. Dazu wurde eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, die zum Ziel hat, 1.200.000 € von Spendern einzusammeln, um so 1000 Geflohenen ein Vollstipendium zu ermöglichen. Es kamen bereits genug Spenden zusammen, damit die Kiron University ihren Betrieb aufnehmen konnte.
Ausblick
Natürlich wäre es an dieser Stelle verfrüht, das Projekt zu beurteilen. Sollte es jedoch erfolgreich sein, dann könnte es einen wesentlichen Beitrag für eine erfolgreiche Integration entwurzelter Menschen in eine neue Gesellschaft sein. Gleichzeitig könnte es sich als ein beachtenswertes Instrument erweisen, um den politischen Herausforderungen einer alternden Bevölkerung und beklagtem Fachkräftemangel entgegenzutreten.
Literaturhinweise
„Stuttgart 21" - Bürger mischen sich ein Buchabschnitt
In: Jörg Sommer (Hrsg.): Kursbuch Bürgerbeteiligung #1, Verlag der Deutschen Umweltstiftung , Berlin, 2015, ISBN: 978-3942466141.
Die Auseinandersetzung um „Stuttgart 21“ und die Zukunft der repräsentativen Demokratie Buchabschnitt
In: Jörg Sommer (Hrsg.): Kursbuch Bürgerbeteiligung #1, Verlag der Deutschen Umweltstiftung , Berlin, 2015, ISBN: 978-3942466141.
Akzeptanz in der Medien- und Protestgesellschaft: Zur Debatte um Legitimation, öffentliches Vertrauen, Transparenz und Partizipation Sammelband
Springer VS, Wiesbaden, 2014, ISBN: 978-3658061661.
Die Protestierenden gegen „Stuttgart 21" - einzigartig oder typisch Buchabschnitt
In: Frank Brettschneider; Wolfgang Schuster (Hrsg.): Stuttgart 21: Ein Großprojekt zwischen Protest und Akzeptanz, S. 97-126, Springer VS, Wiesbaden, 2013, ISBN: 978-3658013790.
Stuttgart 21: Ein Großprojekt zwischen Protest und Akzeptanz Sammelband
Springer VS, Wiesbaden, 2013, ISBN: 978-3658013790.
Dialog statt Konfrontation. Bürgerbeteiligung beim Aus- und Umbau des Energiesystems Artikel
In: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Bd. 63, Nr. 3, S. 100-103, 2013.
Stiftung Bertelsmann (Hrsg.): 2013.
Akzeptanzbeschaffung als Legitimiationsersatz: Der Fall Stuttgart 21 Artikel
In: Leviathan, 2012.