Transparenz als Risiko
Eine Herausforderung: Digitale Transparenz und breite Beteiligung

Die Beteiligung von Bürger*innen hat insbesondere bei kommunalen Vorhaben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Gleichzeitig ist die Umsetzung anspruchsvoll, oft aufwendig und bedarf diverser Kompetenzen. Gute Beteiligung gelingt nur, wenn eine ganze Reihe von Grundsätzen befolgt wird. Die Allianz Vielfältige Demokratie hat diese schon vor geraumer Zeit herausgearbeitet und in diversen Publikationen ausführlich erläutert.
Dabei weist die Allianz darauf hin, dass es insbesondere steter Bemühungen bedarf, die Beteiligung breit zu verankern. Ohne diese Anstrengungen ist in der Praxis häufig zu beobachten, dass sich insbesondere jene Milieus beteiligen, die ohnehin in Gesellschaft und Politik besonders hohen Einfluss haben. Der klassische in Beteiligungsprozessen aktive und durchsetzungsfähige Typ ist männlich, um die 50, verfügt über einen hohen Bildungsgrad und ein überdurchschnittliches Einkommen, er kann überzeugend argumentieren und ist in Gruppen tendenziell dominant.
Breite Beteiligung bedarf besonderer Anstrengungen
Sind zu viele, zu wirksame Akteure dieses Typs in kommunalen Beteiligungsprozessen präsent, hat dies gleich zwei problematische Folgen: Zum einen werden die Ergebnisse so wenig repräsentativ. Oft bereichern sie die Planungen und Vorhaben in Verwaltung oder Kommunalparlamenten kaum, denn auch diese Strukturen sind häufig von Akteuren desselben Milieus geprägt. Zum anderen haben durch diese Dominanz gerade jene Einwohnergruppen, denen man reale Möglichkeiten der (kommunal-)politischen Teilhabe bieten will, keine Chance, Selbstwirksamkeit in den Beteiligungsprozessen zu erfahren.
Diese Problematik ist in Fachkreisen bekannt und immer wieder Thema in Debatten, Fortbildungen und Beratungen. Es gibt diverse Methoden und Strukturen, um die geforderte breite Beteiligung zu forcieren, neben einem soliden Beteiligungsscoping in der Frühphase von Vorhaben zählen dazu die gezielte Einbeziehung von in den eher „beteiligungsfernen“ Gruppen anerkannten Multiplikatoren sowie Formen der sogenannten „aufsuchenden Beteiligung“. Häufig genannte Gründe für eine zögerliche Teilnahme dieser Gruppen sind neben Sprach- und Bildungsbarrieren und hoher – auch familiärer – Arbeitsbelastung insbesondere auch ein „Mangel an Informationen und Wissen“. Ohnehin ist Wissen ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor gelingender Beteiligung. Die Allianz Vielfältige Demokratie formuliert den entsprechenden Grundsatz so: „Gute Bürgerbeteiligung basiert auf Transparenz und verlässlichem Informationsaustausch.“
Transparenz ist nicht ohne Risiken
Wissen, Transparenz, Informationsaustausch – drei Begriffe, die eng miteinander verwandt sind, doch nicht dasselbe meinen. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, denn allzu häufig werden hier Begrifflichkeiten gleichgesetzt. In unserer Gesellschaft wird Transparenz gerne mit der Zurverfügungstellung von Information verwechselt, Information gerne mit Wissen, Wissen mit Verstehen. Jede einzelne Verwechslung ist gefährlich. In der Summe kann uns das auf völlig falsche Pfade führen.
Ein Beispiel ist die oft eingeforderte und im Handlungsfeld Open Government viel diskutierte „Digitale Transparenz“. Ist sie dazu geeignet, Beteiligung, gar breite Beteiligung zu fördern?
Nicht ohne Weiteres. Beschränkt sich digitale Transparenz auf die öffentliche Verfügbarkeit von Daten, ist dies zwar grundsätzlich zu begrüßen, nimmt aber in unserer heutigen, datengetriebenen Welt schnell einen Umfang an, der problematisch wird – denn es bedarf einer Menge Ressourcen, um aus diesen Datenmengen entscheidungsrelevantes Wissen zu beziehen. Technische Ausstattung, spezifische Kompetenzen, Zeit und Geld sind nötig, um aus Daten echte Information zu generieren. Das Problem dabei: Exakt jene Gruppen, die ohnehin schon tendenziell als Entscheider in Politik und Verwaltung sowie als Beteiligte überrepräsentiert sind, sind auch jene Gruppen mit dem besten Zugang zu diesen Ressourcen. Mehr „digitale Transparenz“, wenn sie sich in Daten erschöpft, ist so potenziell eher in der Lage, die klassischen Konflikte in der Beteiligung zu verschärfen.
Aus Daten Wissen machen
Reine Datentransparenz genügt also nicht. Aus Daten muss Information werden. Daten müssen aufbereitet, gewichtet, verdichtet, verglichen werden, damit sie für möglichst viele (potenziell) Beteiligte erkennbar, verstehbar und verwertbar sein können.
Das allerdings bringt neue Herausforderungen. Zum einen benötigt diese Aufbereitung umfangreiche Ressourcen, zum anderen ist der gesamte Prozess nicht frei von subjektiven Einflüssen. Welche Daten wähle ich aus? Wie bereite ich sie auf? Womit vergleiche ich sie? Welche Zusammenhänge betone ich, welche lasse ich vielleicht weg? Es ist verlockend, hier mit verhältnismäßig einfachen Mitteln zu manipulieren, besonders, wenn es um Akzeptanz für ein bestimmtes Vorhaben geht. Doch selbst wenn eine solche Manipulation bewusst unterbleibt – sie kann auch unbewusst stattfinden. So wie im vergangenen Jahr bei der Radwegeplanung einer süddeutschen Gemeinde: Die geplante Verkehrsführung funktionierte blendend – für erwachsene Radler*innen. Die für alle transparenten Daten der Frequenzzählung stützten die Planung. Es gab nur ein Problem: Kinder hatten an mehreren Gefahrstellen keine Chance auf freie Sicht. Leider war es ein Schulweg und über 80 Prozent der Nutzer*innen waren Kinder. „Vergessen“ wurde das aus einem ganz simplen Grund: Keiner der allesamt männlichen Planer war Vater …
Die Aufbereitung von Daten ist also eine sensible Angelegenheit. Und selbst wenn sie bravourös gemeistert werden sollte, ist das noch keine Garantie für deren Relevanz, denn seit einigen Jahren beobachten wir ein weiteres Problem:
Die wissensbedingte Ignoranz
In der Geschichte der Menschheit hat sich das Wissen stetig vermehrt. Eine Grundannahme hat sich dabei jedoch bis heute nicht bestätigt: Ein Mehr an Wissen führt nicht zwangsläufig zu besseren Entscheidungen. Wir wissen heute nicht alles, aber alles, was wir wissen müssen, um zum Beispiel den Klimawandel zu bekämpfen. Warum tun wir es nicht? Weil wir zu viel wissen? Nicht ganz. Der wahre Grund ist die „Beliebigkeit des Wissens“.
Selbst der gebildetste Mensch kann heute nur einen winzigen Bruchteil des Menschheitswissens zur Kenntnis nehmen. Dieser Bruchteil wird durch das ungeheure und globalisierte Wissenschaffen im Vergleich zum Menschheitswissen täglich kleiner. Wir wissen nicht zu viel, obwohl wir durchschnittlich älter werden und immer länger lernen. Aber es gibt zu viel Wissen. Also müssen wir auswählen. Oftmals wählen andere für uns aus. Und sollten wir es doch einmal selber tun, neigen wir dazu, uns für jenes Wissen zu begeistern, dass unsere Ansichten, unsere Meinungen, unsere Haltung, unsere Urteile und Vorurteile bestätigt.
Homo sapiens ist auch Homo ignorans. Menschen vermeiden oft Wissen, das verstört oder beunruhigt. Es gibt Akademiker*innen, die die Nachrichten ausschalten, wenn sie zu schlecht werden. Das Wissen über die krisenhafte Welt wird immer verstörender und wirft immer größere Fragen auf. Die große Verstörung treibt viele Menschen in bewusste Ignoranz – und dann auch allzu leicht in scheinbare Wahrheiten oder die Flucht in Phantasiewissen. Ob Leugnung, Ignoranz oder Eskapismus – jene, die sich nicht auf das ständig erneuernde, anstrengende und oft verstörende Wissen einlassen, laufen Gefahr, wenig zu reflektieren. Allzu leicht sind sie sich dann ihrer Sache – und ihres relativ begrenzten Wissens – sicher.
Wer wenig weiß und nicht wissen will, hat oftmals kein gutes Gefühl für die eigenen blinden Flecken – das Nichtwissen, von dem wir nicht einmal wissen, dass wir es haben. Die verschiedenen Formen des Nichtwissens wie Unsicherheit, Unbestimmtheit, Ignoranz und die blinde Flecken bilden ein System. Bei fehlender Reflexion interagieren sie miteinander und treiben uns ohne Weiteres entweder in Hybris oder in Verwirrung – oder noch gefährlicher: beides.
Als hätte es dieser Einsichten überhaupt noch bedurft, hat uns die Corona-Pandemie besonders drastisch vor Augen geführt, wie auch gebildete Menschen rasch in Verschwörungsnarrative abgleiten können, konventioneller Berichterstattung nicht mehr glauben wollen, ungesicherte Informationen als vermeintliche Wahrheit annehmen und sie in Echo-Kammern weiterentwickeln. In Zeiten der Krise und Unsicherheit haben es nachprüfbare und mühevoll erarbeitete wissenschaftliche Befunde besonders schwer – vor allem, wenn sie komplizierter sind als die ‘alternativen Fakten’.
Die daraus leicht resultierende Beliebigkeit ist die wahre Tragödie des Wissens. Sie entwertet Wissen, weil es so kaum noch als Handlungsgrundlage taugt. Diese Entwicklung ist auch deshalb problematisch, weil sie einen typischen Handlungsansatz von Verwaltungen, politischen Institutionen und Eliten komplett ins Leere laufen lässt: Ignoranz, Kritik, Vorurteile, Ablehnung durch „Fakten“ zu überwinden. Die einfache Gleichung: Mehr Information = weniger Emotion = mehr Akzeptanz funktioniert nicht mehr – und das längst nicht mehr nur bei denen, die wir „bildungsferne“ Gruppen nennen.
Die Beliebigkeit des Wissens, die Skepsis gegenüber Fakten, das völlige Ausblenden von Tatsachen, die nicht zur eigenen Sichtweise passen, ist zwischenzeitlich selbst bis weit in akademische Kreise verbreitet. Die Liste der Corona-Verschwörungsfanatiker*innen mit Professoren- und Doktortiteln ist lang.
Diese Entwicklung ist eines der größten Risiken unserer Zeit: Wir wissen täglich mehr, und täglich steht uns allen, dank moderner digitaler Strukturen, mehr Wissen zur Verfügung. Gleichzeitig entwertet eben dieses Überangebot unser Wissen, weil es so kaum noch als Handlungsgrundlage taugt. Denn wir fühlen uns vom Anspruch des Wissens oft überfordert.
Entscheidend ist der Umgang mit Nichtwissen
Tatsächlich ist die zentrale Herausforderung gerade in demokratischen Prozessen, ob in Parlamenten oder in Beteiligungsstrukturen, der Umgang mit Nichtwissen – und mit Wissensgefälle.
Verwaltungen und ihre Akteur*innen wissen mehr über die meisten Prozesse, die beteiligungsrelevant sind, als die meisten Beteiligten. Doch ihr Mehr an Wissen verschafft ihnen kaum ein Mehr an Respekt. Ihr Wissensvorsprung hilft nicht. Dieses Wissen einfach auf den „virtuellen“ Tisch zu packen, die totale digitale Transparenz herzustellen, nutzt eben auch nichts – oder nur Wenigen.
Digitale Transparenz als Zuverfügungstellung von Daten löst letztlich keines der Probleme, die in Beteiligungsprozessen relevant sind. Sie nutzt denen, die über die Ressourcen verfügen, um sich für sie relevantes Wissen daraus zu generieren, sie verschärft existierende Ungleichgewichte in den Teilhabechancen. Sie ist keine Voraussetzung für Gute Beteiligung, sie ist ein Risiko.
Bei vielen Themenfeldern macht es Sinn, zu Beginn eines Diskursprozesses nötiges Wissen zur Verfügung zu stellen. Doch schon bei einer gewöhnlichen Verkehrswegeplanung übersteigt das Maß an Wissen den Anteil des von den Beteiligten Verdaubaren um ein Vielfaches.
Eine bloße Herstellung von „Transparenz“ durch wahre Informationslawinen hilft da wenig. Im Gegenteil: Oft erzeugt dies genau die Beliebigkeit im Wissen, die wir oben skizziert haben: Jeder sucht sich aus dem Wissen aus, was ihm passt.
Der Umgang mit Nichtwissen ist in einer Demokratie ein ganz entscheidender Resilienz-Faktor. Die Akzeptanz von Nichtwissen bei allen Beteiligten, die Erkenntnis, dass Wissen zwar absolut ist, der Umgang damit jedoch Verhandlungssache, schmerzt nicht nur Wissenschaftler*innen und Philosoph*innen. Sie ist aber Grundlage einer Demokratie – und eine zentrale Grundlage wertschätzender Beteiligungskultur. Denken wir daran, dass Debatten in Beteiligungsprozessen wissensbasierte Planungen und Entscheidungen ja eben nicht ersetzen, sondern ergänzen sollen. Beteiligungsdebatten sind eben immer Debatten mit weniger Wissenden. Das wertet den Dialog keinesfalls ab.
Da wir alle in einer Welt leben, deren Wissen wir unmöglich vollständig erfassen können, hat derjenige, der mehr weiß, nicht automatisch recht. Er hat allenfalls bessere Durchsetzungschancen. Auf jeden Fall hat er die Chance, seine wissensbasierten Überlegungen einem Diskurs auszusetzen, der nach anderen Kriterien verläuft: Er basiert weniger auf Wissen, eher auf subjektiven Interessen, idealerweise auf Ethik, oft auch auf Phantasie.
Das Erstaunliche dabei ist, dass solche Prozesse oft tatsächlich am Ende qualitativ bessere Ergebnisse generieren. Denn erst wenn Wissen, Ethik und Interessen ausbalanciert werden und die beste Lösung mit einer Prise Phantasie gefunden wurde, dann haben wir Ergebnisse, die nicht nur umsetzbar, sondern auch gesellschaftsfähig sind. Das unterscheidet uns Menschen von Algorithmen.
Und das ist auch gut so.
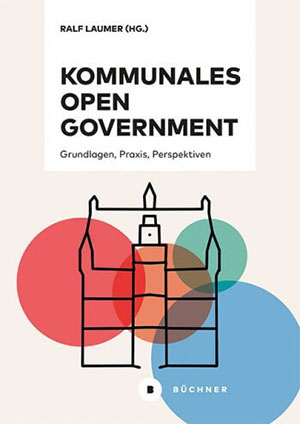 Dieser Beitrag von Jörg Sommer ist auch im Buch „KOMMUNALES OPEN GOVERNMENT“ enthalten, das Anfang Mai 2021 im Büchner Verlag erschienen ist. Der von Ralf Laumer, Leiter des Dezernatsbüro der Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf, herausgegebene Sammelband bündelt Erfahrungen aus der Arbeit vor Ort und macht diese für die Praxis nutzbar.
Dieser Beitrag von Jörg Sommer ist auch im Buch „KOMMUNALES OPEN GOVERNMENT“ enthalten, das Anfang Mai 2021 im Büchner Verlag erschienen ist. Der von Ralf Laumer, Leiter des Dezernatsbüro der Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf, herausgegebene Sammelband bündelt Erfahrungen aus der Arbeit vor Ort und macht diese für die Praxis nutzbar.
Kommunales Open Government: Grundlagen, Praxis, Perspektiven
Herausgeber: Ralf Laumer
Büchner Verlag 2021, 272 Seiten
ISBN: 978-3-96317-246-5
22,00 Euro, Weitere Informationen
